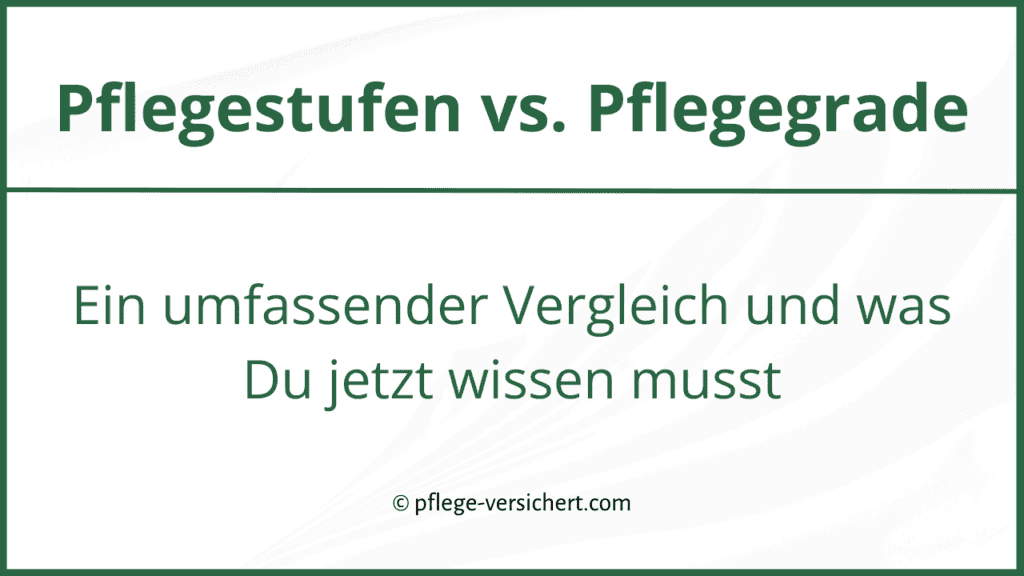
Ein kleines Wort (Grad statt Stufe) ändert so viel! Annähernd alles was man glaubt, über die Pflegeeinstufung zu wissen, stimmt nicht mehr. Seit 2017 haben sich nicht nur der Name und die Anzahl der Pflegeeinstufungen verändert. Sondern die Logik der Einstufung hat sich komplett verändert.
Die Reform der Pflegeversicherung im Jahr 2017 brachte eine bedeutende Umstellung mit sich: Die alten Pflegestufen wurden durch das neues System der Pflegegrade ersetzt. Diese Änderung, eingeführt durch das Zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II), zielt darauf ab, eine gerechtere und umfassendere Beurteilung der Pflegebedürftigkeit zu gewährleisten. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Unterschiede zwischen den alten Pflegestufen und den neuen Pflegegraden, die Auswirkungen dieser Änderungen auf Dich als Versicherten und warum es jetzt besonders wichtig ist, deine Pflegeversicherung zu überprüfen. Ganz kurz gefasst früher war der zeitliche Aufwand für die Pflege entscheidend → das ist seit 2017 obsolet.
Bis 2017 waren die sogenannten Pflegestufen das zentrale Bewertungssystem in der deutschen Pflegeversicherung. Dieses System unterschied zwischen vier „Grund“Stufen:
Die Pflegestufen konzentrierten sich hauptsächlich auf den zeitlichen Aufwand für die körperliche Pflege. Dies führte häufig zu Ungerechtigkeiten, da psychische und kognitive Beeinträchtigungen, wie bei Demenzerkrankungen, nur unzureichend berücksichtigt wurden.
Pflegestufe 1 – 3 gab es noch mit dem Zusatz „mit erheblicher Alltagseinschränkung“. Dies sorgte für erhöhte Leistungen und dieser Zusatz wurde zum Beispiel vergeben wenn:
Außerdem gab es in der Pflegestufe 3 noch eine Härtefallregelung für besonders schwere Fälle.
Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) trat zum 1. Januar 2017 das neue System der Pflegegrade in Kraft. Die bisherigen Pflegestufen wurden damit vollständig ersetzt.Die Pflegegrade bieten eine differenzierte und umfassendere Bewertung der Pflegebedürftigkeit und berücksichtigen sowohl körperliche als auch psychische und kognitive Einschränkungen. Eingestuft wird nun in diese fünf Pflegegrade:
Die Beurteilung der Pflegebedürftigkeit erfolgt nun anhand von sechs Modulen:
Die Module werden auf einer klar definierten Punkteskala bewertet, und die Gesamtpunktzahl bestimmt den Pflegegrad. Dieses System ermöglicht eine umfassendere Bewertung der Pflegebedürftigkeit und sorgt dafür, dass auch geringere Beeinträchtigungen und psychische Belastungen berücksichtigt werden.
Durch die Umstellung haben viel mehr Anspruch auf eine Pflegeeinstufung – vor allem durch die Einführung des Pflegegrad 1. Besonders gut erkennbar an der unten dargestellten Übergangsregelung. Also wie bestehende Pflegestufen in die neuen Pflegegrade umgerechnet wurden.
Der Wechsel von den Pflegestufen zu den Pflegegraden brachte einige entscheidende Veränderungen mit sich:
Für den Übergang gab es folgende klare Regel wie bisherige Pflegestufen umgerechnet wurden:
Frau Müller, 75 Jahre alt, wurde vor drei Jahren mit einer mittelschweren Demenz diagnostiziert. Anfangs kam sie mit Unterstützung ihres Ehemannes noch gut im Alltag zurecht. Doch in den letzten Monaten verschlechterte sich ihr Zustand: Sie vergisst immer häufiger, einfache alltägliche Aufgaben zu erledigen, wie etwa das Anziehen oder die Einnahme ihrer Medikamente. Zudem hat sie Schwierigkeiten, sich im Haus zu orientieren und benötigt Hilfe bei der Körperpflege. Früher wäre Frau Müller möglicherweise nur in Pflegestufe 0 eingestuft worden, da ihr körperlicher Pflegebedarf nicht hoch ist. Heute erhält sie Pflegegrad 2, was ihr und ihrer Familie Zugang zu deutlich umfangreicheren Unterstützungsleistungen verschafft, darunter Pflegegeld, Pflegesachleistungen und zusätzliche Betreuungsangebote, die speziell auf Menschen mit Demenz ausgerichtet sind.
Herr Schmidt, 68 Jahre alt, leidet seit 15 Jahren an Multipler Sklerose. In den letzten fünf Jahren hat sich seine Erkrankung verschlechtert: Die MS führt zu starken Muskelspastiken und einer erheblichen Einschränkung der Mobilität. Herr Schmidt ist nicht mehr in der Lage, längere Strecken ohne Rollstuhl zurückzulegen, und benötigt Hilfe bei der Körperpflege und beim Anziehen. Auch seine Feinmotorik ist stark eingeschränkt, sodass er beim Essen und bei der Medikamenteneinnahme Unterstützung benötigt. Früher hätte Herr Schmidt in Pflegestufe II eingestuft werden können, abhängig von der benötigten Zeit für die Pflege. Heute wird er in Pflegegrad 3 eingestuft, was eine umfassendere Unterstützung gewährleistet, einschließlich umfangreicher Pflegesachleistungen und Unterstützung durch Pflegepersonal, das auf die besonderen Bedürfnisse von MS-Patienten geschult ist.
Frau Neumann, 60 Jahre alt, arbeitet als Lehrerin und leidet seit einigen Jahren an leichter Arthrose, die ihre Bewegungsfähigkeit etwas einschränkt. Sie hat Schwierigkeiten, längere Zeit zu stehen oder zu gehen, benötigt aber keine ständige Betreuung. Sie hat Schwierigkeiten bei einigen Aufgaben des täglichen Lebens, wie z. B. bei der Hausarbeit oder dem Heben schwerer Gegenstände, kommt aber sonst im Alltag gut zurecht. Im alten System hätte sie wahrscheinlich keine Einstufung in eine Pflegestufe erhalten, da ihre Einschränkungen als zu gering angesehen worden wären. Mit dem neuen System hat sie nun Pflegegrad 1 erhalten, wodurch sie Anspruch auf einen Entlastungsbetrag von 125 Euro monatlich hat, den sie für Unterstützung im Haushalt oder für Betreuungsangebote nutzen kann. Zudem kann sie weiterhin uneingeschränkt arbeiten, was ihr die finanzielle Sicherheit gibt, trotz ihrer leichten Pflegebedürftigkeit aktiv im Berufsleben zu bleiben.
Mit der Einführung der Pflegegrade haben sich auch die Leistungen und die Flexibilität der Pflegeversicherung deutlich verbessert:
Eine erfolgreiche Einstufung in einen Pflegegrad kann einen erheblichen Einfluss auf die zur Verfügung stehenden Leistungen haben. Hier sind einige praktische Tipps, um den Pflegegrad erfolgreich zu beantragen oder zu erhöhen:
Herr und Frau Weber, beide über 80 Jahre alt, leben seit über 50 Jahren in ihrem Eigenheim. Herr Weber leidet an schwerer Arthrose, die seine Mobilität stark einschränkt. Er benötigt Hilfe beim Aufstehen, Anziehen und bei der Körperpflege. Seine Frau unterstützt ihn so gut es geht, aber auch sie hat gesundheitliche Probleme: eine beginnende Demenz, die sich durch zunehmende Vergesslichkeit und Orientierungslosigkeit bemerkbar macht. Das Ehepaar hatte ursprünglich Pflegegrad 2 erhalten. Durch eine detaillierte Dokumentation des Pflegeaufwandes und mit Unterstützung durch den Hausarzt konnte das Ehepaar eine Erhöhung auf Pflegegrad 3 beantragen. Nach einer erneuten Begutachtung wurde beiden Pflegegrad 3 bewilligt, was zu deutlich höheren Pflegeleistungen und einer Entlastung für die pflegenden Angehörigen führte.
Max, ein 35-jähriger Softwareentwickler, erlitt vor zwei Jahren einen schweren Autounfall, der zu einer Querschnittlähmung führte. Anfangs hatte er Pflegegrad 2, da er zwar Unterstützung bei der Körperpflege und bei der Mobilität benötigte, aber geistig vollkommen fit war und weiterhin selbstständig arbeiten konnte. Über die Zeit stellten sich jedoch zusätzliche gesundheitliche Probleme ein, darunter chronische Schmerzen und Blasenfunktionsstörungen, die eine intensivere Betreuung erforderten. Durch eine erneute Begutachtung und die Vorlage medizinischer Berichte, die den gestiegenen Pflegebedarf belegten, konnte Max erfolgreich Pflegegrad 4 beantragen. Dies brachte ihm neben einer höheren finanziellen Unterstützung auch Zugang zu spezialisierter Pflege und Hilfsmitteln, die ihm den Alltag erheblich erleichtern.
Viele Menschen sind trotz einer leichten Pflegebedürftigkeit weiterhin berufstätig. Das neue Pflegegrad-System ermöglicht mehr Flexibilität in diesem Bereich:
Rechte und Pflichten als pflegebedürftiger Arbeitnehmer: Es ist wichtig, die Rechte am Arbeitsplatz zu kennen und gegebenenfalls Anpassungen oder Unterstützung durch den Arbeitgeber zu fordern. Das deutsche Arbeitsrecht bietet hier einige Schutzmechanismen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Pflegebedürftigkeit zu gewährleisten.
Pflegegrad 1 und Erwerbstätigkeit: Personen mit Pflegegrad 1 können weiterhin uneingeschränkt arbeiten und erhalten gleichzeitig Unterstützung, um die Selbstständigkeit zu erhalten.
Pflegegrad 2 und eingeschränkte Erwerbstätigkeit: Auch bei Pflegegrad 2 ist eine teilweise Erwerbstätigkeit möglich, abhängig von der Art der Beeinträchtigung und den individuellen Fähigkeiten.
Die Umstellung auf Pflegegrade macht es notwendig, bestehende private Pflegeversicherungen zu überprüfen:
Außerdem solltest Du generell prüfen ob die ve
Frau Schulze, 58 Jahre alt, hat eine private Pflegezusatzversicherung abgeschlossen, die sowohl ambulante als auch stationäre Pflege abdeckt. Nach einer Knieoperation und aufgrund fortgeschrittener Arthrose erhält sie Pflegegrad 1. Sie arbeitet weiterhin in Teilzeit als Buchhalterin und nutzt den Entlastungsbetrag der Pflegeversicherung für eine Haushaltshilfe, die ihr im Alltag unterstützt. Durch die Anpassung ihrer privaten Pflegezusatzversicherung kann sie diese Leistungen flexibel in Anspruch nehmen, was ihr ermöglicht, weiterhin berufstätig zu bleiben und ihre Unabhängigkeit zu bewahren.
Herr Braun, 72 Jahre alt, hat eine Pflegezusatzversicherung, die er vor vielen Jahren abgeschlossen hat. Diese Police basiert noch auf dem alten System der Pflegestufen. Nachdem er an Parkinson erkrankt ist und seine Mobilität eingeschränkt ist, stellt sich heraus, dass die Police eine Anpassung benötigt, um die neuen Pflegegrade widerzuspiegeln. Nach Rücksprache mit seinem Versicherer und einer Vertragsprüfung stellt Herr Braun fest, dass seine Versicherung aktualisiert werden kann, um die zusätzlichen Pflegegrade zu berücksichtigen und ihm mehr Flexibilität und höhere Leistungen zu bieten.
Die Umstellung auf das neue System der Pflegegrade hat viele Vorteile gebracht, insbesondere für Menschen mit leichten Beeinträchtigungen oder kognitiven Problemen. Es ist jedoch wichtig, dass du deine Situation regelmäßig überprüfst und sicher stellst, dass Du dich rechtzeitig optimal abgesichert bist. Die Reform zielte darauf ab, die Pflege in Deutschland gerechter und transparenter zu gestalten und bietet viele neue Möglichkeiten, die du individuell nutzen kannst, um dich abzusichern.
Vor allem durch das transparente Einstufungssystem (siehe Rechner (LINK) oder hier die Richtlinien des Medizinischen Dienst (LINK)) ist das System der Pflegegrade ein Fortschritt.
Die Pflegeversicherung in Deutschland hat sich weiterentwickelt, um den Bedürfnissen der Menschen besser gerecht zu werden. Mit den Pflegegraden wurde ein System geschaffen, das mehr Flexibilität und eine gerechtere Verteilung von Leistungen ermöglicht. Nutze die neuen Möglichkeiten und stelle sicher, dass deine Versicherung optimal zu deiner Lebenssituation passt!
Die Pflegestufen basierten auf dem Zeitaufwand für körperliche Pflege, während Pflegegrade ein umfassenderes Punktesystem nutzen, das auch kognitive und psychische Einschränkungen berücksichtigt.
Du kannst einen Pflegegrad bei deiner Pflegekasse beantragen. Ein Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MD) oder Medic Proof führen eine Bewertung durch.
Mit Pflegegrad 2 hast du Anspruch auf Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege, Entlastungsbetrag und Pflegehilfsmittel. siehe tabelle oben
Eine Erhöhung des Pflegegrades kann beantragt werden, wenn sich der gesundheitliche Zustand verschlechtert. Eine erneute Begutachtung durch den MD oder Medicproof ist dafür notwendig.
Ja, insbesondere bei Pflegegrad 1 und teilweise bei Pflegegrad 2 ist es möglich, weiterhin berufstätig zu sein, während du gleichzeitig Unterstützung erhältst. Die Berufstätigkeit ist kein Kriterium für den Pflegegrad.
Der Pflegegrad wird anhand eines Punktesystems ermittelt. Die Gutachter bewerten die Selbstständigkeit in verschiedenen Lebensbereichen, die in sechs Module unterteilt sind.
Ja, wenn du mit der Einstufung nicht einverstanden bist, kannst du innerhalb von vier Wochen nach Erhalt des Bescheids Widerspruch einlegen.
Die Pflegegrade werden regelmäßig überprüft, vor allem wenn sich der Gesundheitszustand ändert. Bei einigen Pflegegraden erfolgt eine turnusmäßige Überprüfung alle zwei bis drei Jahre.
Du kannst verschiedene Hilfsmittel wie Rollatoren, Pflegebetten, Toilettenstühle oder Inkontinenzprodukte beantragen. Die genaue Auswahl hängt von deinem individuellen Bedarf und dem Pflegegrad ab.
Ja, der Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro pro Monat kann für haushaltsnahe Dienstleistungen, Alltagsbegleiter und weitere Entlastungsangebote genutzt werden. Achtung, diese müssen zertifiziert sein, damit die Kosten übernommen werden.
Wenn dein Pflegebedarf steigt, kannst du einen höheren Pflegegrad beantragen. Mit einem höheren Pflegegrad erhältst Du auch höhere Leistungen.
Ja, wenn sich dein Gesundheitszustand verbessert oder der Gutachter feststellt, dass der Pflegebedarf gesunken ist, kann der Pflegegrad herabgestuft werden.
Pflegende Angehörige können unter bestimmten Bedingungen Beiträge zur Rentenversicherung erhalten, wenn sie eine Person mit mindestens Pflegegrad 2 zu Hause pflegen. Hier sollte man die Details beachten.
Nein, die Begutachtung zur Feststellung des Pflegegrades wird von der Pflegepflichtversicherung bezahlt und ist für dich immer kostenfrei.
Ja, du hast die Wahl zwischen Pflegegeld, Pflegesachleistungen oder einer Kombination aus beidem. Du kannst entscheiden, ob du die Pflege selbst organisierst oder einen Pflegedienst beauftragst.